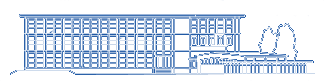FRIAS-Reihe "linguae & litterae"
linguae & litterae
Publications of the School of Language & Literature, Freiburg Institute for Advanced Studies
Herausgegeben von Peter Auer, Gesa von Essen und Werner Frick.
Die im Verlag De Gruyter (Berlin/Boston) erscheinende Schriftenreihe linguae & litterae, herausgegeben von Peter Auer, Gesa von Essen und Werner Frick, dokumentiert die wissenschaftlichen Aktivitäten der School of Language & Literature des Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) im Bereich einer theoretisch und methodisch avancierten, interdisziplinär geöffneten Sprach- und Literaturwissenschaft.
In der Linguistik liegt der Akzent auf der korpusbasierten, quantitativen und qualitativen Erforschung von Sprache, in der Literaturwissenschaft auf der komparatistisch-transdisziplinären Analyse literarischer Phänomene in ihren kulturellen Kontexten. Zugleich nimmt die Reihe die produktiven Kontakt- und Synergiezonen zwischen moderner Linguistik und Literaturwissenschaft (und den mit ihnen im Austausch stehenden Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften) in den Blick und sucht nach neuen, für die zeitgemäße Reformulierung des humanwissenschaftlichen Forschungscurriculums richtungweisenden Fragestellungen und Konzepten.
Die internationale Ausrichtung der Reihe findet ihren Ausdruck in der konsequenten Mehrsprachigkeit der Bände, in denen deutsch-, englisch- und französischsprachige Beiträge, ggf. auch Artikel in italienischer und spanischer Sprache, erscheinen werden. Jeder Einzelband wird im Rahmen eines peer-review-Verfahrens durch ein international besetztes Editorial Board begutachtet.
Weitere Informationen finden Sie hier
Hinweise für Autorinnen und Autoren
Bisher veröffentlichte und in Kürze erscheinende Bände
 |
Band 22 Arthur Schnitzlers intertextuelles Erzählen Aurnhammer, Achim Intertextuelle Anleihen und Bezugnahmen auf literarische Muster prägen Arthur Schnitzlers erzählende Schriften viel stärker als bisher bekannt. Die kürzlich rekonstruierte ‚virtuelle Bibliothek‛ Schnitzlers erlaubt es, die intertextuellen Bezüge in seinem Werk zu präzisieren und die produktive Verarbeitung der Lektüren sowie die Dialogizität von Prätext und Posttext genauer zu bestimmen. Der vorliegende Band vereint exemplarische Studien solcher Prosatexte, die erstens markant die interpretatorische Ergiebigkeit der ‚virtuellen Bibliothek‛ belegen, zweitens Schnitzlers intertextuelle Produktionsästhetik in ihren unterschiedlichen Facetten besonders augenfällig zeigen und die drittens die Frage beantworten lassen, ob und inwieweit Schnitzlers Verfahren während seiner dichterischen Laufbahn eher konstant bleiben oder dynamischen Entwicklungsprozessen unterworfen sind. Dank der Unterscheidung von figuraler und narratorialer Intertextualität lassen sich auch die Personalisierung der Anleihen und ihre Funktion genauer deuten. Folgende Erzähltexte werden untersucht: Die Toten schweigen (1897), Die Nächste (1899), Lieutenant Gustl (1900), Andreas Thameyers letzter Brief (1902), Der letzte Brief eines Literaten (1917), Fräulein Else (1924) und Die Traumnovelle (1926). weitere Informationen finden Sie hier |
 |
Band 21 Realisms in Contemporary Culture Theories, Politics, and Medial Configurations Hrsg. v. Birke, Dorothee / Butter, Stella ‘Realism’ is a pervasive term in discussions of contemporary developments in the cultural sphere. By drawing on different theories of realism, the authors explore how the term may be used as a helpful concept in order to analyse and evaluate current trends in cultural production and, in turn, how cultural production changes our understanding of what counts as ‘realism’. The contributions deal with realism in narrative fiction, drama and audiovisual media (film, television news) within the context of national traditions: examples drawn on in the case studies range from Africa, Britain, Germany, Iceland, Russia, Turkey to the United States. While the authors take their cues from media-specific ‘realisms’, focusing especially on narrative fiction, the volume also highlights continuities and intersections between notions of realism in different genres and media. With its original essays, this collection invigorates the transdisciplinary engagement with forms and socio-political functions of realism in contemporary culture. weitere Informationen finden Sie hier |
 |
Band 20 Interaction and Mobility Language and the Body in Motion Hrsg. v. Haddington, Pentti / Mondada, Lorenza / Nevile, Maurice How do people interact when they are on the move? How do people interact in order to be mobile? How do people coordinate the mobility of others? How does mobility feature in social interaction? ‘Multimodal interaction’ and ‘mobility’ are of increasing interest to scholars across disciplines. Interaction and mobility is the first book to study these aspects comprehensively. It provides cutting-edge research by international scholars who use video-recordings of real-life everyday interactions for studying in close detail human social interaction in such diverse multimodal settings as airplanes, cars, traffic control centres, dance schools, museums and other public places, and as part of such activities as instructing, navigating, identifying an enemy on the battlefield, organising a meeting, playing videogames, shopping, performing and dancing. Together, these studies highlight features of social interaction, including language, embodied conduct, and spatial and material orientation, for being mobile, for interacting on the move, so that mobility becomes a ubiquitous feature of our lives. This book is a valuable resource to anyone interested in multimodal interaction and mobility. weitere Informationen finden Sie hier |
|
Band 19 Nachkriegsmoderne Transformationen der deutschsprachigen Lyrik 1945-1960 In diesem Band untersucht der Autor die Transformationen der deutschsprachigen Lyrik zwischen 1945 und 1960. Problematisiert wird das literarhistorische Analysemodell, demzufolge die westdeutsche Nachkriegsliteratur nach dem nationalsozialistischen Traditionsbruch vor allem durch eine Anverwandlung der ‚klassischen‛ Moderne westlicher Prägung charakterisiert sei. Deshalb geht es zunächst um die Rekonstruktion von Moderne als Diskussionszusammenhang, der im literarischen Leben nach 1945 sukzessive reflektiert und neu ausgehandelt wird, vor allem mit Blick auf kulturkritisch geprägte literaturpolitische Selbstverständigungsprozesse der frühen Nachkriegsjahre. Im Zentrum stehen exemplarische Studien zu Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Günter Eich, Peter Huchel, Karl Krolow, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Peter Rühmkorf und Hans Magnus Enzensberger. Ergebnis der Untersuchung ist die kritische Revision der prominenten Auffassung einer raschen Assimilation von Poetiken der lyrischen Moderne nach 1945. Stattdessen wird Nachkriegsmoderne als komplexe ästhetische Übergangs- und Orientierungsphase vor dem Hintergrund der von Restauration und Modernisierung geprägten janusköpfigen 1950er Jahre vorgeschlagen. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 18 Prosody and Embodiment in Interactional Grammar Hrsg. v. Bergmann, Pia / Brenning, Jana / Pfeiffer, Martin / Reber, Elisabeth Studies in Interactional Linguistics have provided impressive evidence of the systematic use of vocal, verbal, and visual resources in social interaction. While members of the field have discussed what role these resources play in a grammar of social interaction, they have focused primarily on lexico-syntactic structures. The contributions to the present volume, however, focus on prosody and embodiment, exploring the role prosody plays in interactional meaning-making and how visual-spatial resources such as gesture and gaze relate to the use of verbal and vocal resources. This volume includes contributions on Danish, English, French, German, and Swedish interaction, with a primary focus on Interactional Linguistics and additional work from multimodal corpora. This volume will be of theoretical and methodological interest to readers with a background in Linguistics, Conversation Analysis, and multimodal corpora. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 17 Dialectological and Folk Dialectological Concepts of Space Current Methods and Perspectives in Sociolinguistic Research on Dialect Change Hrsg. v. Hansen, Sandra / Schwarz, Christian / Stoeckle, Philipp / Streck, Tobias In variational linguistics, the concept of space has always been a central issue. However, different research traditions considering space coexisted for a long time separately. Traditional dialectology focused primarily on the diatopic dimension of linguistic variation, whereas in sociolinguistic studies diastratic and diaphasic dimensions were considered. For a long time only very few linguistic investigations tried to combine both research traditions in a two-dimensional design – a desideratum which is meant to be compensated by the contributions of this volume. The articles present findings from empirical studies which take on these different concepts and examine how they relate to one another. Besides dialectological and sociolinguistic concepts also a lay perspective of linguistic space is considered, a paradigm that is often referred to as “folk dialectology”. Many of the studies in this volume make use of new computational possibilities of processing and cartographically representing large corpora of linguistic data. The empirical studies incorporate findings from different linguistic communities in Europe and pursue the objective to shed light on the inter-relationship between the different concepts of space and their relevance to variational linguistics. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 16 Comic und Literatur: Konstellationen Hrsg. v. Schmitz-Emans, Monika Die vielfältige Kontaktaufnahme des Comics mit der Literatur und der Literatur mit dem Comic ist in der literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschung bislang kaum Thema gewesen. Die Beiträge des Bandes verdeutlichen das breite Spektrum an Aspekten, unter denen die Beziehung zwischen Comic und Literatur zu betrachten ist, an verschiedenen Beispielen. Behandelt werden u.a. Alberto Breccia, Dino Buzzati, Dante, Alan Moore, Reinhard Kleist, Marcel Proust und Joann Sfar. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 15 Meid, Christopher: Griechenland-Imaginationen Reiseberichte im 20. Jahrhundert von Gerhart Hauptmann bis Wolfgang Koeppen
Griechenland dient bis weit ins 20. Jahrhundert als ein zentraler, teilweise hoch ideologisierter Projektionsraum für die deutsche Identitätsfindung und -konstruktion. Auch nach Abflauen des traditionellen Philhellenismus ist der Bezug auf dieses Land unter veränderten Vorzeichen aktuell: Nietzsches Tragödien-schrift, die Arbeiten von Jacob Burckhardt und anderen Autoren bilden den Hintergrund dieser Versuche, sich einer immer noch als maßgeblich erachteten Kultur anzunähern. Dabei kommt gerade der Reiseliteratur eine besondere Bedeutung zu, da sie besondere Strategien der Authentisierung und Beglaubigung ermöglicht. Diese Studie untersucht deutschsprachige Reiseberichte über Griechenland aus dem Zeitraum von 1908 bis 1962, den Erscheinungsjahren der Texte von G. Hauptmann und W. Koeppen. Erstmals wird ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Griechenland-diskurses zugänglich gemacht, in übergreifenden Strömungen verortet und eingehend analysiert: Die Bandbreite reicht von den Subjektivitätsentwürfen der Jahrhundertwende (Hauptmann, Hofmannsthal) über die politisch akzentuierten Reiseberichte aus der Weimarer Republik und dem Dritten Reich (Kästner) bis hin zu den skeptischen Distanzierungen der Nachkriegsjahre (Koeppen). weiter Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 14 Wissensformen und Wissensnormen des Zusammen-Lebens Literatur - Kultur - Geschichte - Medien Hrsg. v. Ette, Ottmar Die Debatte um die Frage nach dem Lebenswissen hat weiter an Fahrt aufgenommen, seitdem der Begriff im Jahr 2007 von Ottmar Ette in die kultur-wissenschaftliche Diskussion eingeführt wurde. Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge versuchen, diese Diskussion entscheidend voranzutreiben und neue Horizonte aktuellen wie künftigen literatur- und kulturwissenschaftlichen Denkens und Handelns aufzuzeigen. Der Band geht auf ein internationales Symposium zurück, das im Juli 2010 am Freiburg Institute for Advanced Studies stattfand. Der Stil wissenschaftlicher Konvivenz, der bei diesem Symposium geschaffen wurde, kommt in allen hier versammelten Texten zum Ausdruck. Europäische wie außereuropäische, philologische wie philosophische, fachgeschichtliche wie medienhistorische, erzähl-theoretische wie literarästhetische, transkulturelle wie transdisziplinäre Ansätze messen die Dimensionen eines Forschungsgebietes aus, dessen Wissens-formen und Wissensnormen es selbst noch näher zu bestimmen gilt. Dieser Herausforderung ist der Band verpflichtet. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 13 Linguistic Complexity. Hrsg. von Bernd Kortmann / Benedikt Szmrecsanyi (2012) Linguistic complexity is one of the currently most hotly debated notions in linguistics. The essays in this volume reflect the intricacies of thinking about the complexity of languages and language varieties (here: of English) in three major contact-related fields of (and schools in) linguistics: creolistics, indigenization and nativization studies (i.e. in the realm of English linguistics, the “World Englishes” community), and Second Language Acquisition (SLA) research: How can we adequately assess linguistic complexity? Should we be interested in absolute complexity or rather relative complexity? What is the extent to which language contact and/or (adult) language learning might lead to morphosyntactic simplification? The authors in this volume are all leading linguists in different areas of specialization, and they were asked to elaborate on those facets of linguistic complexity which are most relevant in their area of specialization, and/or which strike them as being most intriguing. The result is a collection of papers that is unique in bringing together leading representatives of three often disjunct fields of linguistic scholarship in which linguistic complexity is seen as a dynamic and inherently variable parameter. weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 12 Counterfactual Thinking – Counterfactual Writing. Weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 11 Zahlen, Zeichen und Figuren Der Sammelband fragt nach dem Verhältnis zwischen der Mathematik und den schönen Künsten vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Untersucht wird der Einfluss mathematischer Wissensordnungen, Quantifizierungs-, Formalisierungs- und Abstraktionsverfahren auf das musikalische, bildkünstlerische und poetische Schaffen. Aus der Fülle der herangezogenen historischen Paradigmen wird deutlich, dass die Bereitschaft der Komponisten, Künstler und Dichter, sich durch die Eigentümlichkeit der Mathematik herausfordern und ästhetisch inspirieren zu lassen, viel größer war als gemeinhin angenommen wird. Im Vordergrund der Beiträge stehen einerseits thematische Reflexionen des Mathematischen in Kunst und Literatur, andererseits mathematische Ordnungsprinzipien formaler ästhetischer Gestaltungsprozesse. Die interdisziplinäre Zusammenschau dieser Austauschverhältnisse lässt erkennen, dass die Künste für die kulturwissenschaftliche Reflexion einen Schauplatz darstellen, auf dem sich verschiedenste Stränge der Geschichte des Wissens miteinander kreuzen und zu komplexen ästhetischen Konfigurationen verdichten. Der Band bietet somit eine reiche, aktuelle Materialgrundlage für Forschungen an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaften. Weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 10 Monika Schmitz-Emans: Literatur-Comics. Adaptionen und Transformationen der Weltliteratur. Comics und Graphic Novels stehen in einer doppelten ästhetischen Tradition: Verfasser von Metacomics (Eisner, McCloud) betonen sowohl die Fundierung in der Geschichte der bildenden Kunst als auch die Beziehung zu Formen erzählerischer Darstellung. Viele Klassiker der Weltliteratur wie Goethes Faust, Melvilles Moby Dick und die Erzählungen Kafkas haben eine ganze Reihe von Umsetzungen in den Comic erfahren, und heute existiert ein eigener Kanon des Literaturcomics. Diese engen Beziehungen des Comics zur Literatur werden in den Kapiteln dieses Bandes anhand von Beispielen aus dem internationalen Kanon ausführlich analysiert. Die ausgewählten Comic-Adaptionen werden exemplarisch vorgestellt und theoretisch reflektiert. Diese Monographie wird sowohl der Comic- als auch der Intermedialitätsforschung als Standardwerk dienen und ihnen wichtige Impulse verleihen. Weitere Informationen finden Sie hier |
|
|
Band 9 Unnatural Narratives - Unnatural Narratology In recent years, the study of unnatural narratives has become an exciting new but still disparate research program in narrative theory. For the first time, this collection of essays presents and discusses the new analytical tools that have so far been developed on the basis of unnatural novels, short stories, and plays and extends these findings through analyses of testimonies, comics, graphic novels, films, and oral narratives. Many narratives do not only mimetically reproduce the world as we know it but confront us with strange narrative worlds which rely on principles that have very little to do with the actual world around us. The essays in this collection develop new narratological tools and modeling systems which are designed to capture the strangeness and extravagance of such anti-realist narratives. Taken together, the essays offer a systematic investigation of anti-mimetic techniques and strategies that relate to different narrative parameters, different media, and different periods within literary history. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 8 Figurenwissen. Funktionen von Wissen bei der narrativen Figurendarstellung Der Sammelband liefert einen Beitrag zum Forschungsgebiet ‚Literatur und Wissen‘ und knüpft zugleich an die jüngere narratologische Diskussion zu literarischen Figuren an. Er präsentiert eine Reihe von Fallstudien, die Figurendarstellungen in fiktionalen narrativen Texten aus verschiedenen Nationalliteraturen und Epochen (vom 14. bis zum 20. Jahrhundert) analysieren. Die allen Einzelstudien übergeordnete Frage ist die nach den Funktionen des Wissens bei der Produktion und Rezeption literarischer Figuren: Untersucht wird, wie historische Formationen anthropologischen Wissens in literarische Figurenkonzeptionen eingegangen sind, wie Autoren die narrative Figurengestaltung zur Vermittlung von Wissen über Geschichte und Gesellschaft nutzen und welche Wissensstrukturen in die Rezeption literarischer Figurendarstellungen involviert sind. Die literaturwissenschaftlichen Untersuchungen werden ergänzt durch Beiträge aus Geschichtswissenschaft, Linguistik und Philosophie, die sich mit Figuren- bzw. Personendarstellungen außerhalb der Literatur und mit den Konzepten der Person und der personalen Identität befassen. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 7 Oliver Steven Ehmer: Imagination und Animation. Die Herstellung mentaler Räume durch animierte Rede (2011) Aus gesprächsanalytischer Perspektive untersucht die vorliegende Arbeit ein mentales Phänomen: Imagination in Gesprächen. In Verbindung von Interaktionaler Linguistik und Kognitiver Semantik wird Imagination als ein Prozess modelliert, in dem Sprecher gemeinsam szenisch strukturierte mentale Räume schaffen. Imagination wird damit sowohl als konversationelle Aktivität, als auch als Prozess gemeinsamer Kognition (Shared Cognition) verstanden. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 6 Constructions: emerging and emergent. Hrsg. von Peter Auer / Stefan Pfänder (2011) On the basis of empirical studies on spoken English, German, Hebrew, Swedish and French, the volume addresses the following questions: How can what initially appears to be construction x end up being construction y in on-line syntax? What are the local interactional needs which such processes respond to in the process of their emergence? Does the on-line (re-)modelling of a construction concern its syntactic or semantic side - or both? And finally: Should emergent grammatical structures as they unfold in real time be seen as stages in the emerging of grammar? Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 5 Visuelle Evidenz. Photographie im Reflex von Literatur und Film. Hrsg. v. Barbara Korte / Sabina Becker (2011) Gilt die Fotografie im 19. Jahrhundert nahezu uneingeschränkt als ein Authentizität verbürgendes Medium, so wird im 20. Jahrhundert in Literatur und Film genau diese dem fotografischen Verfahren zugeschriebene Eigenschaft problematisiert, aber auch variiert. Anhand konkreter Fallstudien aus Literatur und Film fragen die hier versammelten Beiträge nach der Evidenz der Fotografie und der Inszenierung dieser Evidenz in anderen, spezifisch erzählenden Kunstformen. Die Autorinnen und Autoren sind germanistische, anglistische und romanistische Literatur- und Kulturwissenschaftler sowie Medienwissenschaftler. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 4 Literatur und Wissen. Theoretisch-methodische Zugänge. Hrsg. v. Tilmann Köppe (2010) Der Band entwirft eine Übersicht über das komplexe philologische und philosophisch-ästhetische Forschungsfeld zum Thema ‚Literatur und Wissen‘. Die Beiträge sichten und sortieren das Feld und entwickeln Ansätze zu einer Bewertung vorliegender Theorien und Methoden. Der Vielzahl existierender Fallstudien wird damit eine primär theoretische Perspektive an die Seite gestellt. Behandelt werden u.a. die Explikation der Kernbegriffe ‚Literatur‘ und ‚Wissen‘; Probleme der textuellen Repräsentation von Wissen; die Einordnung der Wissensvermittlung in das Funktionsspektrum (fiktionaler) Literatur; und die Rekonstruktion vorliegender Forschungsprogramme zum Thema. Weitere Informationen finden Sie hier Rezension:Thomas Petraschka, Die Vermessung der Forschungswelt. Aktuelle theoretische Perspektiven zur Problemkonstellation ›Literatur und Wissen‹. (Review of: Tilmann Köppe [Hg.], Literatur und Wissen. Theoretischmethodische Zugänge. Berlin/New York: de Gruyter 2011.) In: JLTonline (25.03.2011) (http://www.jltonline.de/index.php/reviews/article/view/316/903).
|
|
|
Band 3 Anna Alissa Ertel: Körper, Gehirne, Gene. Lyrik und Naturwissenschaft bei Ulrike Draesner und Durs Grünbein (2010) Die deutschsprachige Lyrik der 1990er Jahre ist durch eine intensive Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften gekennzeichnet. Die vorliegende Arbeit untersucht einen Ausschnitt dieser „wissenschaftsaffinen“ Lyrik, nämlich Gedichte, die Themen oder Motive aus den modernen Bio- wissenschaften, insbesondere aus den Bereichen Medizin, Neurowissenschaften und Genetik, aufgreifen. Im Zentrum stehen die Werke Durs Grünbeins und Ulrike Draesners, die das Profil der Lyrik stark geprägt haben und für das Unter- suchungsthema einschlägig sind: Viele ihrer Gedichte kreisen um den menschlichen Körper und inszenieren ihn im Spannungsfeld von subjektiver Erfahrung einerseits und objektiver Vermessung, Zurichtung und Manipulation durch Medizin und Wissenschaft andererseits. Am Körper, so scheint es, lassen sich die Folgen unmittelbar ablesen, die die Entwicklungen in den Biowissenschaften für unser Menschenbild haben, und als solcher gerät er in den Fokus der Literatur. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 2 Thomas Klinkert: Epistemologische Fiktionen. Zur Interferenz von Literatur und Wissenschaft seit der Aufklärung (2010) Vor dem Hintergrund der im 18. Jahrhundert erstmals manifest werdenden funktionalen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft wird das Verhältnis zwischen Literatur und Wissenschaft an Beispielen aus dem französischen (Diderot, Rousseau, Balzac, Flaubert, Zola, Proust, Houellebecq), deutschsprachigen (Goethe, Freud, Musil), italienischen (Vico, Manzoni, Pirandello, Svevo, Calvino, Del Giudice) und spanischsprachigen Bereich (Pío Baroja, Borges, Cortázar, Volpi) untersucht. Dabei zeigt sich, dass es trotz der zunehmenden Trennung der Bereiche (die C. P. Snow auf die Formel der ‚zwei Kulturen‘ gebracht hat) immer wieder zu poetologisch und epistemologisch aufschlussreichen Interferenzen von Literatur und Wissenschaft kommt. Während im 18. Jahrhundert literarische Texte noch einen Platz in der offiziellen Wissensordnung hatten, wächst im 19. Jahrhundert das Bewusstsein für die grundlegende Differenz der Bereiche. Aufgrund der Dominanz der Naturwissenschaften und des Positivismus versuchen literarische Texte seit Balzac sich durch die poeto logische Funktionalisierung (natur-)wissenschaftlicher Modelle zu legitimieren. Im 20. Jahrhundert werden in der teilweise skeptischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Modellen die Grenzen der Literatur ausgelotet. Weitere Informationen finden Sie hier
|
|
|
Band 1 Günter Saße: Auswandern in die Moderne. Tradition und Innovation in Goethes Roman "Wilhelm Meisters Wanderjahre" (2010) An zwei großen Werken hat Goethe jahrzehntelang gearbeitet: am Faust II und an Wilhelm Meisters Wanderjahren. In ihnen thematisiert er den Beginn des 19. Jahrhunderts als Epocheneinschnitt, der das Ende jahrhundertealter Traditionen und den Anbruch der Moderne markiert. Insbesondere Goethes Altersroman zeigt dabei, wie sich das ‚Neue‘ als durchgängige Utilitarisierung aller Wirklichkeitsbereiche manifestiert. Die vorliegende Studie deutet die Wanderjahre allerdings nicht bloß als Spiegel geschichtlicher Vorgänge, sondern als Reflexionsmedium, das Wissensbestände der Gegenwart und Vergangenheit integriert, um sie im Handeln und Erleben der Protagonisten dem ‚anschauenden‘ Verstehen zu präsentieren. Der Rückgriff auf die Fülle der Prolegomena, Tagebuchaufzeichnungen, Briefäußerungen und Schematisierungen Goethes sowie die Berücksichtigung seines ökonomischen, kulturellen, technischen und sozialgeschichtlichen Wissens vermittelt dabei ein tieferes Verständnis des Romans: Herausgestellt wird, dass er die mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen, kulturhistorischen Transformationen und ökonomischen Veränderungen seiner Zeit weder pauschal verurteilt noch befürwortet, sondern durch ein multiperspektivisch-offenes Arrangement diagnostiziert und problematisiert. Weitere Informationen finden Sie hier
|